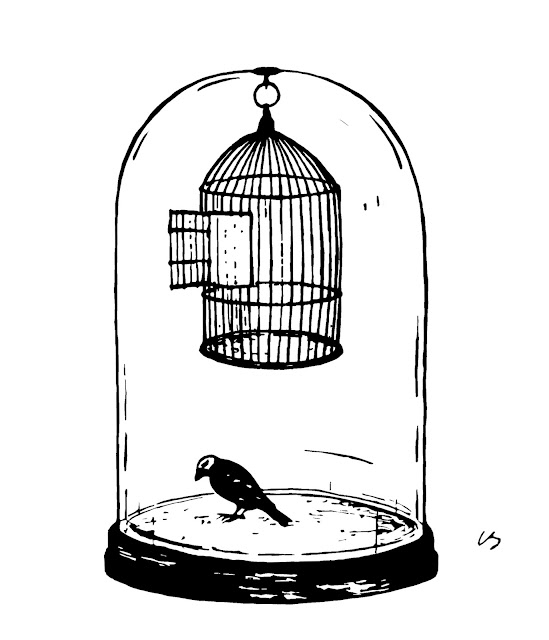Ein neues Kalenderjahr, ein neues Objekt: Wieder ist alles
anders, Touristenenge und Funkverkehr sind wieder passé, stattdessen schickt mich
die Arbeit in die winzig kleine Antithese zu Fürstenpalais und Museumsschloss,
schickt mich in ein modernes Ersatzteillager, einer Art Museum auf Abruf – ein
offener, diskursiver, heller, zahnarztweißer, kleiner Kunstraum für städtische
Ankäufe und jugendliche Entdeckungen. Das Gebäude selbst entdeckt leider fast
niemand, ich betrete ein schüchternes Schmuckkästchen, das gerade den Besitzer
wechselte und nicht recht weiß, für wen es nun funkeln soll; die neue
Museumsleitung scheint niemanden im Haus zu erfreuen, eher zu beunruhigen (wie
wird es weitergehen, und wo soll das sein?). Ich kann nicht mitreden, nur
zuhören, wie so oft, versuche nachzuvollziehen, wie politisch (un)motivierte
Kulturentscheidungen getroffen werden und wozu ich überhaupt hier bin.
Über Stunden und Tage werde ich erstmal eingeschult, und das
heißt: schau dir die Kunst an, zähl die Gäste, sei freundlich, fühl dich wie
zuhause, nimm noch eine Tasse Kaffee. Ich sitze mit den Kollegen hinter der
Kassentheke – tatsächlich, ich sitze – warte auf den Andrang, der nicht kommt, lese, was da ist, und freue mich über
den Tag, der nicht schlimm ist, der nicht einmal lang ist, sondern einfach nur
ist. Ein Fastentag, der nichts braucht und nichts vermisst.
Heute sind wir zu dritt und zu viele, ein junger Mitarbeiter
vom Haus, ein Firmenkollege und ich. Der Firmenkollege ist bekannt, ich traf ihn
bereits in mehreren Objekten, er ist einer dieser bewundernswerten, offenen
Menschen, die immer etwas erzählen können und sich mit kindlicher Ausdauer an
sinnfreien Leidenschaften erfreuen. Sein Steckenpferd? Die Goldgräberei. Da
gibt es diese Schatzsucherdoku auf einer Insel, jeden Sonntag, ein
Pflichttermin. Ob ich nicht glaube, dass die Sendung echt ist? Nein, das kann
natürlich schon alles inszeniert sein, klar, aber wie spannend das gemacht ist,
sagenhaft! Obwohl die ja nie etwas finden (außer Enttäuschung), und heute Abend
gleich wieder, gleich eine Doppelfolge, nein, da muss alles passen, Cola,
Chips, alles griffbereit. Klar.
Nein, er wisse schon, das ist vielleicht nichts, aber man muss
sie sich behalten, diese kleinen Siege, und außerdem erhält man da wertvolle
Tipps. Immer wieder kommt er an diesem Museumssonntag auf die Insel und das
Goldthema zurück, und ich merke bald, dass ihn die Goldgräberei wirklich beschäftigt. In den besucherleeren
Stunden googelt er Metallsuchgeräte, zeigt mir einen Anbieter in der Stadt,
wägt den Preis ab, erzählt von seiner Herangehensweise: Man muss bei den
lokalen, heimischen Sagen anfangen, dort ist der Start. Man muss lesen und aussieben,
in welchen Tälern von Gold die Rede ist, und dort beginnen. Ja, natürlich ist es unwahrscheinlich, dort noch was zu finden, aber wenn!
Der Tag geht weiter und weiter, das Außenlicht nimmt langsam
ab, noch eine Stunde. Irgendwann erwähne ich, dass ich schreibe, der Kollege
gibt mir ein paar Tipps von Stephen King weiter, wir reden über Texte und Wahrscheinlichkeiten,
bis sich schnell wieder die Insel in den Vordergrund drängt … und diese endlose
Suche nach diesem verfluchten Goldschatz, von dem niemand sicher weiß, ob er
überhaupt existiert. Und vielleicht, denke ich später, vielleicht ist gerade das
der Reiz an der Goldgräberei: nach etwas zu schürfen, das vielleicht gar nicht
da ist, einer Aufgabe zu folgen, die vielleicht vollkommen sinnlos, ziellos und
für immer unabgeschlossen bleibt, und gerade in dieser Absurdität den Traum
atmet, in dem es nicht mehr um den eigentlichen Gewinn geht, sondern um das bloße
Versinken in der Idee eines Gewinns.
Vielleicht (sehr wahrscheinlich) finde ich ein Leben lang nichts – doch ich
habe geatmet, ich habe geschürft und ich habe nicht aufgehört.
Kurz vor Schichtende nimmt mich der Kollege zur Seite und
sagt mir mit breitem Grinsen, die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann mal
ein echtes Stück Gold findet, ist größer, als dass ich mal von der Schriftstellerei
leben kann. Darauf sein Lachen, komödienhaft, und wenig später ergänzt er, das
war natürlich nicht ernst gemeint, das wisse ich schon. Ich weiß es, klar, er
ist einer von den Guten, den natürlich Guten, die ernsthaft Böses gar nicht aussprechen
können. Und doch ist etwas Wahres dran: Denn obwohl sein Vergleich mit dem
Schreiben und dem Gold nicht ernst gemeint war, obwohl nur unbedacht im Spaß
gesagt, so hat er, ohne es zu wissen, absolut Recht damit.