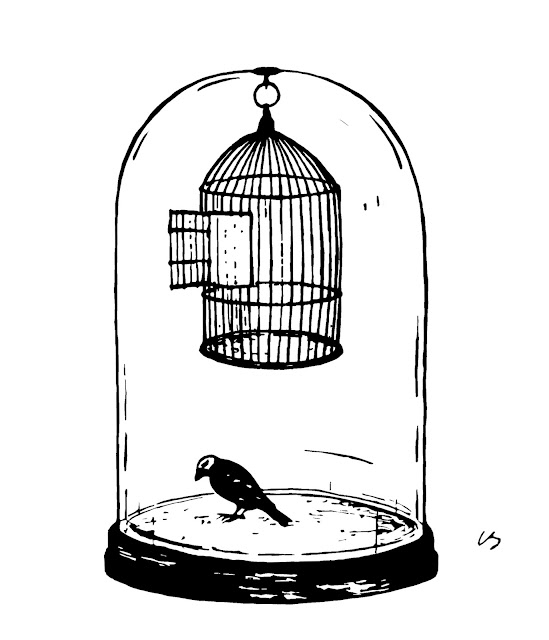Donnerstag, 20. Dezember 2018
Donnerstag, 13. Dezember 2018
Freitag, 30. November 2018
Gefühl der Heimat
Es gibt eine beliebte Buchhandlungskette in der Stadt, es ist unmöglich, sie nicht zu kennen. Unmöglich, das Logo nicht schon einmal gesehen zu haben, das mit der grünen Dame, mit der namensgebenden, windigen, grünen Muse, die
den kobaltblauen Schriftzug neben ihr anlächelt oder verbläst, je nachdem.
Heute stehen die Zeichen auf Sturm. Es ist der 28. November 2018
und wieder trete ich in ihre Filiale am Rand der Flaniermeile, presse mich durch eine unzählbare Masse an Menschen, als wäre ich immer noch im Museum, gefangen im monetschen Ausnahmezustand. Und irgendwo, da stimmt es auch, für mich ist es ein Museum: Jedes
Buch ein Exponat, jede Bindung ein Kunststück, jeder U4-Text ein
Kuratorenwitz. Es ist ein Museum ohne Aufsicht, eine Ausstellung zum
Anfassen, bunt, global und wechselhaft, hunderte, tausende Künstler
und Werke, in die man sich hineinlesen muss. In dieses Museum verschlägt es
mich, tagein, tagaus, hier stöbere, suche, finde ich die Bücher, die
ich später in einem Laden kaufe, von dem niemand das Logo kennt. Weil er keines
hat, nie eines haben wird.
In der Kettenfiliale dagegen ist alles Logo. Auf Regalen, am
Sackerl, auf Lesezeichen, Übersichtsplänen, überall prangt die kobaltblaue
Schrift, der Name, die Marke.
Sie ist es, die die Massen abholt, die Räume und Konten füllt. Menschen mögen
Marken, immer schon. Ein frittengelber Doppelbogen, eine zweischwänzige Kaffeenixe,
eine grüne Büchermuse – die Marke schenkt Vertrauen und Zuversicht. Immer schon ist sie bekannt, nie
überrascht sie; und was nicht überrascht, kann nicht enttäuschen. Sie ist das
Wissen: Was ich hier bekomme, das ist vielleicht lieblos, ist vielleicht
überteuert, ist vielleicht nicht besonders – aber ich bekomme es. Die Marke ist
der Schutzpatron der Beständigkeit. Sie ist der Tod der Überraschung, das Ende
des Empfindens. Sie ist Wohlstand. Ein Privileg.
Die Filiale auf der Flaniermeile hat drei Stockwerke. Im
ersten Stock ist eine Toilette, auf der Toilettentür ein Schild, auf dem Schild
eine Information. Sie lautet: „Aus Gründen der Sicherheit und Hygiene bitte
[sic] wir sie [sic] keine Ware in den Toilettenbereich mitzunehmen. Vielen
Dank für Ihr Verständnis!“ – Nein, ich erfinde, ich träume das nicht, ich will schwören, dieses Schild existiert, und es
ist wohl tatsächlich die beste, die klarste Erklärung für ein diffuses Gefühl, das sich immer nur schüchtern und unvollständig erklären lässt: Das Gefühl meiner Heimat. Die Marke hat mir die Überraschung genommen,
dieses Schild nimmt mir die Mündigkeit. Ich lebe in einem reichen, demokratischen Staat, in dem das
Bedürfnis herrscht, seine Bürger schriftlich darauf hinweisen zu
müssen, keine ungekauften Bücher zum Scheißen auf eine Buchhandlungstoilette
mitzunehmen. Aus Gründen der Sicherheit und Hygiene.
Heute ist der 28. November 2018, nur zwei Länder weiter
tritt gerade das Kriegsrecht in Kraft, und in meiner nächsten Umgebung herrschen akute Sicherheitsbedenken, dass der Volksverstand nicht ohne Hinweis fähig ist, seine
Notdurft in der Halböffentlichkeit ohne ungekaufte Neuware zu verrichten.
Soviel Freiheit, soviel Frieden und Wohlstand zu besitzen, um einen solchen Hinweis überhaupt formulieren zu können (der, im schlimmsten Fall, seine Berechtigung hat) – das, würde ich
sagen, ist die Kurzfassung dessen, was meine Heimat ausmacht
oder kleinmacht, je nachdem. Ein Privileg.
Montag, 26. November 2018
Position und Sprache
Ein Grund, warum ich meinen schlechten Job so mag, sind
meine Kollegen. Ich arbeite neben wundersamen, unwahrscheinlichen Menschen mit diversesten Lebensläufen und
Geburtsflaggen, ich diene weniger den vereinzelten Museen, als den Vereinten
Nationen: Österreich, Ungarn, Italien, Deutschland, Schweiz, Schweden, Rumänien,
Serbien, Kosovo, Türkei, Tunesien, Syrien, Iran, Ägypten, Kanada – ich kenne
keinen Beruf, in dem mehr Internationalität herrscht als in der
Museumsaufsicht.
Ein paar meiner Kollegen sind geflüchtet, viele studiert,
niemand verbohrt. Die meisten haben Träume, oder zumindest Ziele, andere hatten
sie, leben jetzt das Scheitern, ich bewundere sie alle. Viele sind jung, viele
sind Teilzeit, manche über Fünfzig, alle unterbezahlt. Es ist die eine, die große
Klammer, die uns alle eint, die Ironie der Gerechtigkeit in der Geringschätzung:
egal, wie alt, egal, welches Geschlecht, egal, woher man kommt, egal, wie lange
man die Stelle hält – wir alle verdienen gleich wenig. Nirgendwo herrscht mehr
Gleichberechtigung als in einer Berufsposition, die nichts verspricht.
Hier, in den fensterlosen Ausstellungsräumen, hier gibt es
keine geschlechtsabhängigen Gehaltsscheren, gibt es weder Über- noch
Unterqualifikation, weder Bevorzugung noch Ausschließung. Jede und jeder ist herzlich
willkommen, für einen Hungerlohn Position zu beziehen und sich die Kniescheiben
schleichend zu zermürben; solange man nur annähernd die Sprache
beherrscht. Es ist wirklich die einzige Voraussetzung für den Dienstanzug: Sprechen Sie Deutsch. Und jedes Mal, bei
jedem Dienst, freue ich mich über die unikalen Akzente im Funkverkehr, die
durchklingenden Herkünfte, die in mein Ohr rauschen, und ich kann wieder nicht
fassen, wie man sich diese abgrundtief alogische deutsche Sprache innerhalb
kürzester Zeit aneignen kann, wie man Deutsch überhaupt als Fremdsprache lernen
kann oder möchte, und zu welch einmaligen Versprechern die Unbedarftheit fähig ist
und wie überwältigend poetisch die winzigen grammatikalischen Fehlpässe meiner
ausländischen Kollegen durch mein Gehör klingen und mir den Tag retten. Ein
Haufen Dichter, und keiner von ihnen weiß es.
Es ist schon wieder ein Mittwoch, ich stehe wieder zwischen Monets
Millionenimpressionen und unterdrücke meine konstante Müdigkeit, als plötzlich
der Kollege aus Raum 1+2 in meine Richtung hetzt. Er wirkt ausgelöst, in
großer Eile, verlässt seine Position, um mich einzuweihen, ich rechne mit dem
Schlimmsten. Ein Notfall, ein Bildschaden, eine Herzattacke. Der Kollege bleibt
abrupt stehen, nickt mir zu und sagt: „Du bist doch Österreicher, oder? Was ist
der Unterschied zwischen rechnen, berechnen und verrechnen?“ – Ich bin eine
Sekunde verwirrt, vielleicht zwei, dann erst begreife ich und versuche, es ihm zu
erklären; es ist nicht leicht, es ist wirklich nie leicht, die deutsche Sprache
einfach zu erklären, sie simpel und
kurz zu halten. Ich suche Beispiele und Anschaulichkeiten, stottere, gestikuliere,
der Kollege scheint dennoch zufrieden, geht zurück auf Position. Und erst Stunden später erkenne ich, dass die
Antwort auf seine Frage im Grunde kinderleicht und völlig klar ist: rechnen
heißt mit Zahlen spielen, berechnen heißt mit Resultaten spielen, und
verrechnen heißt scheitern, also Leben spielen.
Mittwoch, 7. November 2018
Monet verbindet
Ich lausche. Beobachte und lausche, schärfe meine Sinne,
während ich neben der Gruppe stehe und der unendlich angenehmen, angelernt
klaren Stimme der Kunstvermittlerin folge, die den Massen Monet erklärt. Seit
einigen Wochen schon stehe ich wieder in einem neuen Objekt, dem wertvollsten
Museum der Stadt, und hier, jetzt, heute, setzt Monet die Menschen in den
Fluss, Menschen über Menschen über Menschen, die seinen fließenden Farben
folgen. Nur für ihn, nur für den extravaganten Impressionisten öffnet das Haus schon
eine Stunde früher, lässt mich eine Stunde länger mitfließen und ausfließen.
Ich will ihm böse sein, doch es geht nicht, weil ich seiner Geschichte lausche,
weil sie zu gut ist; Monet mag man eben.
Und tatsächlich, alle mögen ihn, besonders die späten
Semester. Es ist ein Mittwoch, es ist, als würden alle alten Menschen dieser
Stadt einheitlich in die Ausstellung pilgern, durch die fließenden Räume voller
Seerosen, Winterlandschaften und hängenden Gärten. Als hätten sich alle Altersheime
gleichzeitig entleert, ein gemeinsamer Ausgang, vielleicht einer der letzten,
jedes Husten, jeder ihrer Schritte macht mir Sorge. Und immer wieder läutet
ihnen das Telefon, das smarte, das jeder von ihnen besitzt, aber niemand
bedienen kann, und immer wieder ist ihr Klingelton ein Albtraum, und nie finden
sie das Gerät vor dem fünften Läuten, und nie, nie wissen sie sofort, wie man
es abstellt, leiser macht, ausschaltet – warum schaltet ein Pensionist sein
Telefon im Museum nicht aus? Und wer ist das nur, der ihn ständig anruft? Die verschollene Enkelin? Der Hausarzt?
Mit verstörender Verlässlichkeit läuten die Telefone der
alten Massen, nicht nur heute, seit Wochen schon, während mir die Beine schwer
werden, die Sohlen wieder Feuer fangen, und nicht einmal der samtweiche,
monetblaue Teppichboden etwas hilft. Doch ich lausche. Ich lausche weiter und sehe
den so unheimlich beliebten Franzosen in neuem Licht. Und ich erfahre, dass
Schönheit nicht absolut ist, dass selbst Monet nicht immer schon schön war und
sein erster Erfolg erst spät kam, sehr spät, erst mit Fünfzig. Seine erste Einzelausstellung
soll die Leute gar so verstört haben, dass ein Besucher auf die Straße lief und
einen Passanten in den Arm biss. „Warum hast du einen Menschen in den Arm
gebissen?“, hätte man ihn gefragt. „Wegen Monet“, hätte er geantwortet.
Hundert Jahre später gilt dieselbe Kunst, die bis zum
Menschenbiss verstörte, als eine der ästhetischsten, zartesten Farbanordnungen
der Kunstgeschichte. Hundert Ölwerke hängen heute in der Ausstellung, jedes
einzelne in Millionenhöhe versichert. Und er, der seine eigenen Farben mit dem
Alter nicht mehr recht sehen konnte, er verbindet die einstige Ablehnung mit
der heutigen Anerkennung, die Vergangenheit mit der Gegenwart, das Fließende mit dem Konservierten, die Alten mit
den Jungen. Denn da, plötzlich, inmitten all der gebrechlichen Kunstveteranen,
schlüpft ein Kind aus den hustenden Massen, und ich sehe, beobachte, wie es an der
Kunstvermittlerin vorbeischlendert, wie ein verlorenes Wesen in der falschen
Epoche, ein Kind mit Interesse, ein Kind mit Stil, es trägt einen schwarzen
Pullover, und darauf in weißen Lettern die klare Botschaft: NOW IS THE NEW
LATER.
Das ist sie, denke ich, die Wahrheit dieses Mittwochs, das
ist die Zustimmung, die ich geben kann, will, werde. Jetzt muss man in diese
Ausstellung gehen, jetzt muss man schreiben, jetzt muss man Monet mögen – und
wenn nicht für seine Seerosen und Spaghettigärten, dann doch zumindest für die
Tatsache, dass er bis Fünfzig geschmäht wurde und seine Zeitgenossen so aufwühlte,
dass sie sich ineinander verbissen. Monet verbindet.
Donnerstag, 1. November 2018
Dienstag, 16. Oktober 2018
Die vierte Essenz
Sein Leben bestehe im Grunde aus vier Dingen, soll Borges
einmal gesagt haben. Lesen, Denken, Schreiben und Genießen. Letzteres, fügte er
an, sei ihm das Wichtigste gewesen. Warum aber fällt es oft so schwer,
bedingungslos zu genießen, warum wirkt dieses Empfinden wie die Ausnahme und
nicht die Regel? Anders gefragt: Warum fällt es so schwer, in dem Moment zu
sein, in dem Moment sein zu wollen?
Ich denke, es ist so: Ich kann den Moment deshalb nicht
genießen, weil ich eigentlich nicht hier sein möchte. Genuss erfordert
vollkommene Akzeptanz der Gegenwart, die aus Zeit und Raum besteht. Und am Raum
scheitert es; wenn ich die vierte, fünfte Stunde im Museum stehe, wehen meine
Gedanken schon dem Ende der Schicht entgegen, sehnen sich nach dem Andernorts.
Warum? Weil ich Hunger habe, weil die Sohlen brennen, weil ich Lesen,
Schreiben, Schlafen möchte. Dinge, die ich in einer Monet-Retrospektive einfach
nicht tun kann. Dinge, die der Dienstanzug nicht zulässt.
Dabei wäre jede Arbeit, jeder Museumsdienst so viel
angenehmer, wenn ich ihn einfach bedingungslos annehmen würde, wenn ich die
Tätigkeit ohne Sehnsucht genießen könnte. Ich kann eine Dienststunde nicht
genießen, das heißt nichts anderes als: Ich möchte nicht hier sein. Ich möchte
an meinem Esstisch, an meinem Schreibtisch sitzen, möchte mich im
Lichtspielsaal verstecken, die Luft am Flussufer atmen, Kaffee aufsetzen,
vielleicht verreisen. Weil es nicht geht, werde ich ungeduldig, frustriert,
apathisch, im schlimmsten Fall verbittert. Jedes schlechte Gefühl ist ein
Produkt des unglücklichen Zwanges, in einer Situation sein zu müssen, aus der
man nicht raus kommt. Oder rauskommen könnte, aber sich vor den Konsequenzen
scheut. Ein bemüht oberflächliches Gespräch mit einem Kollegen, der mir nichts
sagt: Ich wünschte, ich wäre nicht hier. Jede schmerzhafte, peinliche
Kindheitserinnerung kennt diesen Gedanken, den ersten Gedanken im Moment der
Entblößung: Ich wünsche mich an einen anderen Ort. Ich wünsche mich überall
hin, nur nicht hier, nur nicht in diesen Moment, von dem ich weiß, dass er sich
einprägen wird. Das Gegenteil von
Genuss: Scham.
Mittwoch, 1. August 2018
Brief an Cocteau
Es gibt eine Stelle in Jean Cocteaus Kinder der Nacht, da wird von einem absurden Zimmer berichtet.
Nachdem Elisabeths Angetrauter Michael, ein perfekter, unfassbar amerikanischer Dandy, an seinem teuren Dandyschal krepiert (während der Fahrt im
Sportcabrio weht ein Schalende in die Reifen und reißt seinem Träger
den perfekten Kopf ab), nach diesem unschönen Unfall, wird der jungen Witwe das Haus des Toten vererbt; in das sie kurz darauf mit ihrem Bruder Paul,
einer Schachfigur (Gérard) und einer tragischen Unschuld (Agathe) einzieht. Zu
viert leben sie ohne Verpflichtung, ohne Ziel in Michaels perfekten Milliardärsbau,
der kühl und steril in fünfzig makellosen Grautönen steht.
Bis auf dieses eine, absurde Zimmer. Eine unscheinbare Galerie,
die gar keine ist, die kein Mensch brauchen kann, die trotzdem nicht
weggeht, der störende Rest einer Division mit falschen Zahlen – Kanapee,
Schaukelstuhl, Globus, ein paar Leerstellen, ein Billardtisch, viel zu hohe
Fenster, kurzum: nichts passt zusammen in diesem Zimmer. Und genau dieser Umstand macht ihn zum Herzstück einer sonst seelenlosen Maschine – „wo bei Michael ein
Berechnungsfehler auftrat, dort konnte das Leben erscheinen; dies war der
Augenblick, wo die Maschine menschlich wurde und zurücktrat.“
In den Augen von Elisabeth und Paul ist dieser Raum aus
Stilbrüchen, dieses obskure, heimliche Restzimmer einer vermeintlichen
Perfektion der einzige Ort, an dem das reiche Erbe menschlich wird. Mehr noch:
selbst der tote Besitzer erhält durch dieses Zimmer erst seine Menschlichkeit. Ohne
es zu wissen, hatte Elisabeth diesen reichen Amerikaner nur wegen einer ärgerlichen Rumpelkammer
geheiratet. Denn „dieser ungeheuerliche Abstellraum war Michaels Schwäche, sein
Lächeln, das Beste seiner Seele.“
Ich stelle mir vor, dass Cocteaus Ironie vor diesen Worten stockte, dass sie kurz innehalten musste, weil der Autor an das Empfinden seiner schrecklich jungen Helden wirklich und
fest geglaubt hatte. Weil er wusste, dass die eigentlichen Glanzlichter des Lebens aus seinen
versteckten kleinen Nischen blitzen, die weder Nutzen, noch Vorzeigewert haben,
und gerade deshalb so kostbar sind – sie posieren nicht, sie stehen einfach für
sich. Sie sind verträumte Kunstwerke, Refugien, die niemand brauchen und
niemand schätzen kann, außer diejenigen, die in ihnen wohnen, in ihnen leben.
Dass bei Cocteau noch Intrige, Gift und Selbstmord in dieses
Zimmer finden – geschenkt. Die Tradition des Romans verlangt nach solcher
Tragik, der Erfolg bekräftigt sie. Mich lässt es kalt. Wenn ich Kinder der Nacht lese, interessiert mich
die reine Idee des Zimmers so viel mehr als das spätere Lügenschach, die kalkulierte Liebelei, der Abgang darin. Nicht für den Abriss des Bürgertums, sondern für den Aufbau
eines Kleinkunstreiches bewundere ich Cocteaus zeitlose Erzählung. Für die
feine Hervorhebung dessen, was die Welt sein kann, wenn ich sie so sehen will, sei es auch nur kurz: Ein kunstsinniges Zimmer voller Seele und Stilbrüche, in dem ein lächelndes
Herz schlägt.
Sonntag, 22. Juli 2018
Die abgewandte Eva
Es gibt eine Regel, vielleicht die wichtigste: Jeder
gesunde, erwachsene Mensch hat eine Eigenverantwortung für sein Tun. Hormone?
Ausrede. Druck? Ausrede. Geld? Ausrede. Gott? Tot. Ich allein bin
verantwortlich für meine Entscheidungen, meine Handlungen und Nichthandlungen.
Auch wenn es nie so einfach ist, es nie sein kann; die Verantwortung ist da.
Es gibt welche, die entscheiden sich dafür, von einem Tier
an der Leine gezogen zu werden. Es gibt solche, die entscheiden, ganz bewusst, sich
gegen Geld heiße Tinte in die Haut ritzen zu lassen. Es gibt Menschen, die
entscheiden sich für die Wirtschaft, das Schreiben, den Nachwuchs, Stabhochsprung, die Politik.
Und es gibt Menschen (nicht wenige), die entscheiden sich
dafür, einer Frau auf den Po zu klapsen. Bei meinem heutigen Dienst im
Touristenschloss: im ersten Stock beobachte ich einen Mann (schwarze Lederjacke,
Bauch), der neben einem zweiten an der vergoldeten Fensterbankkante lehnt, direkt hinter
der lebensgroßen, nackten Evastatue von Auguste Rodin, sehr gelassen, fast
gelangweilt. Plötzlich stoßen sich die beiden Männer ab, bewegen sich in den
Raum, vorbei an der Eva im Adamskostüm, und der Lederjackenmann gibt Rodins
verschämtem Meisterwerk im Vorbeigehen zwei – nicht einen: zwei – Klapse auf
den harten Hintern. Ich starre den Typen fassungslos an, er trifft meinen
Blick, ich schüttle den Kopf, er macht eine dumme, entschuldigende Pantomime,
lächelt hinterher, verschwindet mit dem Kumpel im nächsten Raum. Ich bleibe zurück und drehe meinen Kopf zu ihr: Rodins Eva hat
den Blick längst abgewandt, seit 1881 wendet sie den Blick ab, ich kann es ihr wirklich nicht verübeln.
Was bewegt einen Menschen, so zu sein? Wäre ich nicht im
nächsten Moment zur Pause abgelöst, ich wollte die schwarze Lederjacke
aufhalten und sie fragen, warum. Ich habe gesehen, was Sie getan haben, wir
sind zwei erwachsene Menschen, ich möchte nur den Grund, das ist alles.
Natürlich, ich weiß, es gibt die Nur-Sager, wahrscheinlich ist er einer von
ihnen: ist doch kein Mensch, ist doch „nur“ eine Statue. War doch „nur“ Spaß.
Nur, nur, nur – wer hat dieses unnütze Wort überhaupt erfunden? Mit „nur“ ist
nichts zu holen, nichts zu gewinnen, nichts zu entschuldigen.
Ob ich der Skulptur, der Kollegin oder der Direktorin auf
den Hintern klapse – was ändert es? Letztlich gibt es nur eine Frage, die ich
mir stellen muss, jeden Tag aufs Neue: Was
für ein Mensch möchte ich sein? Wenn ich zufällig ein Mann bin, und der
Mensch sein möchte, der Frauen auf den Hintern klapst, dann ist das meine
Entscheidung. Wenn ich in den Fünfzigern, Sechzigern geboren wurde, wird es mich
vielleicht verwundern, warum jetzt so eine große Sache daraus gemacht wird; es
ändert nichts an der Aktion an sich. Ein öffentlicher Klaps auf den Hintern einer Fremden, einer Kollegin,
einer Eva, es war niemals „nur“ ein Klaps. Es war immer schon und wird immer eine ziemlich lächerliche, peinliche, sich selbst erniedrigende und für einen
Beobachter zum Schämen lausige Aktion sein – völlig egal, ob es eine Konsequenz
nach sich zieht oder nicht.
Was für ein Mensch möchte ich sein? Bis heute weiß ich keine
befriedigende Antwort auf diese Frage. Wohl aber weiß ich, was für ein Mensch
ich nicht sein möchte. Leute wie der
Lederjackenmann machen sie mir sehr einfach, diese Entscheidung.
Mittwoch, 18. Juli 2018
Samstag, 14. Juli 2018
Semmeln und Mitleid
Heute möchte ich von einem Kollegen erzählen. Er trägt
Brille, blondes Borstenhaar, bundesheerkurz, hat eine gewölbte Oberlippe, einen
kindlichen, konstant verwunderten Blick. Er ist nicht „von hier“, wie man so
sagt (wie so viele), er kommt aus einem anderen Land ins Museum, es könnte jedes sein, es ist der Kosovo. Die Eltern haben ihn nach der Schule hierher
geschickt, allein. Er wohnt am schönen blauen Fluss, allein, geht zur Arbeit,
allein, wird alleine nach Hause fahren. Wenn die Semmeln beim Bäcker
knusperfrisch sind, freut er sich, er freut sich ehrlich und spricht euphorisch
darüber. Seine Gedanken sind einfach, sein Weltbild ein Kind. Er glaubt felsenfest, dass jeder Chinese Karate kann, doch er glaubt es ohne Ideologie, ohne
Vorsatz oder bösen Willen. Einmal soll er sich im Museum hingelegt haben, weil
er müde war. Ein paar Mal hat er sich im Dienst verlaufen, einmal im Lift
eingesperrt. Manche Kollegen reden nachsichtig über ihn, manche belustigt,
andere meiden ihn, halten sein Tempo nicht aus, verzweifeln an der Schlichtheit.
In manchen Firmenobjekten ist er gesperrt. Es heißt, seine Familie kommt ihn
nie besuchen.
Ich sehe ihn selten, aber ich denke oft an den Kollegen,
zuletzt träumte ich sogar von ihm: Wir arbeiten bei einer faden
Gartenveranstaltung, ich drehe meine Runden um die Gäste, sehe ihn
plötzlich am Boden liegen. Ich hetze zu ihm hin, beuge mich hinab – der Kollege ist zur Kindergröße geschrumpft, das Gesicht rot und verquollen, die
hellen Bundesheerborsten zu fettigen, teerschwarzen Strähnen verwachsen; er
muss etwas vom Catering genascht haben, kombiniere ich umgehend, eine allergische
Reaktion, er bekommt keine Luft. Ich wiege ihn in meinen Armen, beruhige ihn,
rede gut zu, bis er wieder größer und schwerer wird und die roten Wunden langsam
verschwinden, der Atem zurückkommt. Er tut mir Leid, in diesem und in allen
Momenten, denke ich noch im Traum, denke ich weiter, als ich aufwache.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich mich dabei ertappe,
Mitleid mit ihm zu haben. Ich sehe ihn allein und glaube ihn einsam, ohne
Familie, ohne Freunde, ohne reflektierten Geist. Und es stört mich, dieses vage,
falsche Mitleid. Ich schreibe ihm Traurigkeit zu, obwohl ich kein Recht darauf
habe, denn letztlich denke ich dabei wieder nur an mich selbst; ich fühle kein Mitleid,
weil ich weiß, dass es ihm schlecht geht, ich fühle Mitleid, weil ich mir
vorstelle, dass ich mich an seiner Stelle schlecht fühlen würde. Doch woher weiß ich, dass er nicht völlig
anders empfindet, als ich es in seiner Situation täte? Wer sagt, dass er nicht
glücklich und zufrieden sein kann mit seinem Leben, nur weil ich glaube, es nicht selbst führen zu wollen, mit mir?
Ich muss wieder daran denken, was André Breton in seinen surrealen Manifesten über die Tiere schreibt, diese Lebewesen, die wir ständig mit
menschlichen Gefühlen ausstatten, und den Hund „treu“ nennen, nur weil wir
unsere Eigenschaften auf ihn übertragen – was in Folge dazu
führen kann, „Mücken für absichtlich grausam und den Krebs für vorsätzlich
rückschrittlich zu halten.“ Breton nennt diese vermenschlichte Beurteilung der
Tiere eine „bedauerliche Nachlässigkeit des Denkens“, und ich muss ihm
zustimmen, diesem strengen Träumer, muss nicken und will noch ergänzen: Nicht
nur unsere Beurteilung der Tiere ist vermessen und vereinfachend, auch die
Einschätzung der Mitmenschen ist es; wenn sie wieder nur von sich selbst
ausgeht und den Mitmenschen kein eigenes Erleben zugesteht – eines, das völlig
konträr und unverständlich zu meinem eigenen steht; zu dem einzigen, das ich wirklich
kennen kann, wenn überhaupt.
Wie kann ich mich anmaßen, das Empfinden meines
Kollegen zu beurteilen, wenn ich ihn selbst nur flüchtig und oberflächlich
kenne? Es ist völlig unnütz, es ist beschämend und beschränkt, dieses wertende, sture Denken, so
wie Breton es bei einem (zutiefst intellektuellen) Hundeliebhaber feststellte, der
felsenfest davon überzeugt war, was sein Hund für ihn empfindet – um sich damit selbst
besser und geliebter zu fühlen. Und letztlich ist mein schnelles Mitleid auch bloß das: ein Weg, mich selbst besser zu fühlen. So als wäre ich es auch, als wäre
irgendjemand besser als der Kollege, besser als der borstenblonde, junge Mann, der
sich über frische Semmeln freut und ohne Hilfe in einer Stadt zurechtkommt, die
ihm nichts geschenkt hat – und der im Übrigen niemals traurig aussieht, wenn
ich ihn treffe.
Dienstag, 10. Juli 2018
Über Frechheit
„Frechheit siegt“ – nur, es stimmt nicht. Sie führt
vielleicht zum Ziel, zu einem Erfolg, doch dieser Erfolg ist kein Sieg, wenn er nicht nach gewissen Regeln spielt. Wenn die Touristin ihre Tochter gratis ins
Museum schmuggelt, indem sie vorgibt, sie hätte ihr Ticket verloren, wenn der
Tourist ein Wunschbild heimlich fotografiert, obwohl er weiß, dass es nicht
fotografiert werden darf, und doch so tut, als hätte er es nicht gewusst, wenn er ertappt wird, wenn die andere Touristin ein Gemälde anfasst, um das
Verlangen nach Berührung zu stillen, und sich dann überrascht entschuldigt, wenn
der Alarm oder die Aufseherstimme schreit … Dann sind das freche, kindische
Aktionen, die jeden Respekt vor einem Museum vergessen oder ihn nie gelernt haben,
die sich regellos in einer Welt bewegen, deren Regeln sie allzu gut kennen.
Es ist ein seltsames Gefühl: Immer wieder scheint es mir im
Dienst, als beträten viele erwachsene Besucher ein Museum zum allerersten Mal,
als wüssten sie nicht, was das mit den Bildern da ist und wie man sich hier
vielleicht verhalten sollte, weil man der Hausordnung still zugestimmt hat.
Doch es ist ein Trug, ein falsches Bild; niemand ist zum ersten Mal in einem
Museum, der sich die Reise hierher leisten kann, und es ist keine Premiere, es
ist der Charakter, der so tut, als kenne er keine Verbote, der sich jedes Mal wieder
überrascht und schockiert zeigt, dass es in jedem Museum der Welt ein
Rucksackverbot gibt. Und sich in jedem Moment darüber hinwegsetzt, in dem der
Aufseher gerade wegsieht, gerade woanders ist, gerade blinzelt, gähnt, sich umdreht.
Ich habe mich über eine Regel hinweggesetzt: Ich habe meinen
Willen durchgesetzt: Ich bin frech. Der Erfolg gibt der Frechheit Recht, kann
man sagen, er lädt sie zur Wiederholung ein, gibt den Ausführenden ein Glücksgefühl;
doch es ist ein trügerisches. Weil in der Frechheit immer schon ein kleiner
Betrug liegt, und weil dieser Betrug jedes Ziel schmälert, es relativiert und sich damit selbst herabsetzt. Am Ende habe ich nichts erreicht, wenn ich es mit unfairen
Mitteln erreicht habe. Dann steht am Ende zwar der Erfolg (am Beispiel des Museums: ich habe meiner Tochter den Eintritt erspart, habe das Wunschbild
am Handy, den Rahmen berührt), doch ich habe mich dafür selbst erniedrigt, weil ich dafür betrügen
musste. Deshalb ist der Erfolg kein Sieg, sondern eine Niederlage. Weil er
weiß, wie er zustande gekommen ist.
Von außen betrachtet, erreicht mein Leben vielleicht
weniger, wenn ich nicht frech bin, es nicht sein möchte, wenn ich nicht die
Frechheit besitze, meinen Anstand zu betrügen und meinen Willen respektlos
durchzusetzen. Doch erreiche ich nichts, habe ich auch nichts verloren; habe
mich nicht im Betrug erniedrigt, mich nicht selbst oder die Welt belogen –
und mich damit zum Verlierer gemacht.
Nicht nach außen hin, aber innerlich; denn Frechheit verliert. Sie ist schneller, einfacher,
erfolgreicher, aber sie setzt die Frechen selbst herab, wenn sie die Frechheit
besitzen, völlig bewusst frech zu handeln. Und in der Frechheit so zu tun, als gelten
gewisse Regeln nur für alle anderen, aber nicht für sie. Und sich noch darüber zu freuen,
damit durchgekommen zu sein.
Samstag, 30. Juni 2018
Die Regeln des Gewissens
Ich bin verspätet; der Wecker schreit, ich höre es nicht,
die Sonne scheint, ich spüre sie nicht. Der Körper, die Tage davor noch
angeschlagen, schwach, er nimmt sich, was er braucht, und erst der Anruf aus
der Zentrale holt mich aus dem Winterschlaf – ich schrecke hoch, mein Blick auf
die Uhr im Regal, fünf Minuten vor Dienstbeginn. Ich fluche, komme hoch, greife
nach dem Dienstanzug. Renne.
Ich bin oft pünktlich, aber nie zu spät. Heute, das ist das
erste Mal, dafür richtig. Durchgeschwitzt und aufgelöst empfange ich das
Funkgerät in der Zentrale, schreibe mich in die Liste, fünfundvierzig Minuten
nach Dienstbeginn. Ich bin wütend, ehrlich wütend auf mich und meinen Körper,
und melde mich beschämt und klein bei der Oberaufsicht. Heute ist sie es, die Gute, die Freundliche, die Beste. Ich versuche, mich bei ihr zu entschuldigen, die Oberaufseherin wehrt noch im Satz ab – „Nein, nein, ist gar kein Problem, alles gut.
Würdest du heute bitte das Ticket machen? Danke, danke dir!“
Er ist nicht gespielt, dieser Ton, sie ist wirklich so. Wie
Kinder witzig sind, ohne es zu wissen, ist sie natürlich höflich, weil es für
sie selbstverständlich ist, weil sie gar nicht anders kann, und jede
Dienstanweisung noch wie eine Bitte klingt, jedes Lächeln auch so gemeint ist.
Nur dank ihr habe ich die nächsten sieben Stunden und fünfzehn Minuten ein
fürchterlich schlechtes Gewissen. Wäre heute jemand anderes hier, wäre ein
verschwitzter Gorilla heute die Oberaufsicht, würde er mich anschnauzen, den Kopf
schütteln, blöde Sprüche machen über meine Verspätung, es wäre mir gleich.
Ein Mensch, vor dem ich keinen Achtung habe, kann mir nichts anhaben; Wut
und Gebrüll machen jede Person lächerlich winzig, und für ein schlechtes Klima muss ich nicht pünktlich sein (schon gar nicht bei dem Gehalt). Was interessiert mich, was
ein Gorilla von mir denkt? Es tut mir nichts; wäre die heutige Oberaufsicht ein Oberarschloch, mein Gewissen
wäre vollkommen unbelastet.
Doch diese Güte, diese unendlich nachsichtige Reaktion auf
mein Verschlafen, sie zwingt mein Gewissen erst dazu, sich zu regen und zu schämen und zu
versprechen, es das nächste Mal (alle nächsten Male) besser zu machen,
es besser machen zu wollen, weil sie
es verdient hat, diese herzensgute, unendlich angenehme Person, die ich nicht, nie wieder
enttäuschen möchte. Nicht trotz, sondern weil sie es verzeiht, es mir immer verzeihen wird.
Nur dort kann das Gewissen schlecht werden: wo der Umgang gut ist.
Donnerstag, 31. Mai 2018
Mittwoch, 30. Mai 2018
Busters Beitrag
Es gab eine Zeit, da habe ich Buster Yanzell übersetzt; die
meisten seiner Schriften sind unerheblich bis kindisch, doch seine Ansichten
und Beiträge zur Realität-Traum-Verengung sind nach wie vor aktuell. Yanzells Zugang ist erfrischend: Es ging ihm nicht um Freudsche Deutungen, nicht um Analyse, Symbolik, Auswertung, sondern rein um die Tendenzen der Traumdramaturgie; um die Frage, was ihre Erzählung auszeichnet, absondert, kurz: sie bestimmt.
Yanzells „The Theory of How to Not living the Dream“,
in meiner Übersetzung als „Warum ich weiß, dass ich keinen Traum
lebe“ erschienen, verhandelt äußerst prägnant, was die Realität vom
Traumerleben unterscheidet. „Im Traum bin ich immer involviert“, schreibt
Yanzell (nach meiner Fassung), „ein
Umstand, den die Realität nicht zulässt. Höre ich in der Stadt Polizeisirenen,
gehen sie vorüber – im Traum aber sind sie mit mir verbunden, sind die Bullen entweder hinter mir her, überfahren mich oder zwingen mich zu irgendeiner
Handlung, einer Reaktion (ausweichen, einsteigen, verstecken, …). Die
Involvierung ist somit der erste Unterschied. Der zweite ist die Frequenz der
Ereignisse. Wiederholung, Trägheit, Leerlauf lässt kein Traum zu. Im Traum passiert mir immer etwas
(Unerwartetes). Im Leben? Wiederholung auf Wiederholung. Ich wünschte, es würde endlich einmal etwas passieren – ein sicherer,
vielleicht der sicherste Gedanke, um zu wissen, sich nicht im Traum zu befinden. Wer
auf Spannung hofft, der kann nicht träumen. Im Traum aber gibt es keinen
Leerlauf, keine Wartezeit, stattdessen Ereignis auf Ereignis, Involvierung auf
Involvierung. Die Ausnahme wird im Traum zur Regel. Immer passiert die
Ausnahme, immer passiert, was normalerweise nicht
passiert, weil es nicht passieren darf.“
Yanzell weiter: „Beispiel:
Ich bin wach – ich fahre mit dem Taxi von A nach B: ich komme bei B an, ich zahle
und steige aus. Ich träume – ich fahre mit dem Taxt von A nach B: ich erkenne kurz vor B, dass ich kein Geld eingesteckt habe, ich werde ängstlich,
panisch, verzweifelt, komme bei B an, werde gezwungen, mich meiner Angst zu
stellen, und muss die Konsequenz annehmen, sie durchspielen (…).“
Hier ist meine Übersetzung plötzlich fehlerhaft und unvollständig … Es
wirkt, als hätte ich ein Detail übersehen, als fehlte mir ein Absatz, fast so, als
hätte Yanzell selbst einen unerwarteten Sprung gemacht, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Von der Straße tönen plötzlich Polizeisirenen. Im nächsten Moment klopft es an meiner Tür.
„Kommen Sie raus, Buster!“, brüllt eine Stimme. Ich springe panisch auf und
fliehe über die Feuerleiter, renne zur Straße und halte das nächste Taxi an, sage dem Fahrer, er solle aufs Gas treten und mich wegfahren, egal wohin, und erst während
der Fahrt erkenne ich, dass ich kein Geld eingesteckt habe …
Montag, 7. Mai 2018
Der Nichtkönner
Wie kann ich wissen, ob ich etwas kann? Wusste Joyce, als er
1920 an seinem Pariser Schreibtisch saß, dass er etwas schreiben konnte, dass
später der Ulysses wäre?
Wenn ich aber nur im Zweifel schreiben kann (und das will ich glauben), wie kann ich dann gleichzeitig das Vertrauen zu mir selbst aufbauen, dass es braucht, um irgendeine Tätigkeit im Leben fortzusetzen? Wenn ich mir die Zähne putze, weiß ich, dass es klappt. Wenn ich schreibe, weiß ich nichts (sicher). Ich habe einen Gedanken, der mich drängt, eine Idee, ihn festzuhalten, doch ich kann nicht sagen, welche Worte es dafür braucht, bin nicht überzeugt, dass ich das Blatt so abschließen kann, wie ich es mir wünsche. Denn zuallererst ist Schreiben Wunsch – erst mit ihm kommen die Zweifel. Ohne Wunsch, ohne Vorstellung von irgendeiner Art von Ziel, kann es auch nie einen Zweifel daran geben.
Wenn ich aber nur im Zweifel schreiben kann (und das will ich glauben), wie kann ich dann gleichzeitig das Vertrauen zu mir selbst aufbauen, dass es braucht, um irgendeine Tätigkeit im Leben fortzusetzen? Wenn ich mir die Zähne putze, weiß ich, dass es klappt. Wenn ich schreibe, weiß ich nichts (sicher). Ich habe einen Gedanken, der mich drängt, eine Idee, ihn festzuhalten, doch ich kann nicht sagen, welche Worte es dafür braucht, bin nicht überzeugt, dass ich das Blatt so abschließen kann, wie ich es mir wünsche. Denn zuallererst ist Schreiben Wunsch – erst mit ihm kommen die Zweifel. Ohne Wunsch, ohne Vorstellung von irgendeiner Art von Ziel, kann es auch nie einen Zweifel daran geben.
Wenn ich aber versuche, den Stein einfach zu rollen, die
Erwartung auszuschalten und nicht an den Wunsch des Gipfels zu denken, so verfolgt mich
immer noch die Selbstwahrnehmung: Ich sehe mir selbst zu, und ich sehe, dass
die Art und Weise, wie ich den Stein rolle, schlecht ist. Dass ihn jeder andere
Autor besser rollen könnte und auch kann. Und sobald ein Gedanke schlecht ist,
werden es alle: Alles, was ich tue, ist
schlecht. – Das stimmt so nicht, ist praktisch nicht haltbar, und doch kommt sie immer wieder, die Wahrnehmung, die mich tadelt und straft, mich vom Stift
abhält, mich bremst und zurückwirft und aus dem Schreiben bringt, weil
ich es eben nicht kann. Alle paar Tage möchte ich mit dem Schreiben aufhören,
nur um die Stimme loszuwerden, die mir sagt, dass ich schlecht bin, dass ich es einfach nicht kann und niemals können werde, dass auch
dieser Satz im Grunde unbrauchbar und streichfähig ist und ich es gar nicht erst zu versuchen brauche, am Besten sofort abbreche.
Denn wenn ich nichts kann, kann ich mit dem Schreiben auch nicht aufhören.
Donnerstag, 19. April 2018
Über das Träumen
Ich finde es schade, sehr schade, dass Träume keinen Platz in der
Gesellschaft haben. Im Alltag, an dem wir heute festhalten, ist fast jedes
Bedürfnis, jede Tätigkeit zu mehr erhoben worden, als sie ursprünglich
darstellte; nur das Träumen nicht. Aus jedem Laster, jeder Freizeit lässt
sich Kultur gewinnen, ganz leicht sogar, man muss sie nur dazu erklären: es
gibt eine Körperkultur, eine Vereinskultur, eine Esskultur, sogar eine anerkannte
Trinkkultur. Aber keine Traumkultur. Schade, einfach nur das, wie Goyas Traumradierung mit dem Maleräffchen: Ni mas, ni menos.
In der Straßenbahn, im Kaffeehaus, in den vernetzten
Sozialwerken lausche ich Gesprächen, scrolle durch Debatten. Die Leute reden
über das Wetter, über Sport, über die Arbeit und über die Anderen, doch wer redet schon über seine Träume? Ich meine nicht das ideelle, vorauseilende,
karrieregeile Träumen, ich meine das originale, nächtliche, das jeden Menschen
einholt, in jeder Nacht, ob er oder sie sich erinnert oder auch nicht. Wenn wir
uns nicht erinnern, versuchen wir es auch nicht, wenn wir es aber (selten) tun, wird es schnell abgetan, und ich höre Stimmen, die sagen: "Wieder so einen Blödsinn geträumt." Oder: "Träume sind Schäume." Oder, noch
schlimmer: "Das muss etwas bedeuten." Ich will nicht therapeutisch, nicht analytisch über Träume schwurbeln, will sie nicht deuten oder werten, weil
sie nicht danach verlangen. Ich will über Träume reden, wie man über den Kauf einer
neuen Jacke oder eine Reise redet: Man erzählt einfach davon. Ich will nicht
wissen, ob die Reise gut oder schlecht, billig oder teuer war, ich will wissen,
wie es dort ausgesehen hat, an dem Reiseziel, will wissen, welche Eindrücke als
allererstes in den Sinn kommen, welche versteckten, kleinen, absurden Details hängen
geblieben sind.
Es gibt nichts persönlicheres als diese unwiederholbare, nächtliche Reise. Folglich ist auch seine Mitteilung etwas persönliches, vielleicht die persönlichste Erfahrung, die ich von mir preisgeben kann. Einen Traum erzählen, das muss heißen: eine
Erfahrung teilen, die nur ein einziger Mensch unter acht Milliarden genau so machen konnte.
Zumindest will ich das glauben. Denn ich glaube nicht an die Geschichten, an die alten Sagen,
wie etwa jene um Decius Mus, dem ich regelmäßig im Fürstenpalais begegne, im
ersten Stock, wo der wandfüllende Rubens-Zyklus die Geschichte des römischen
Feldherrn erzählt, der in einer Nacht denselben Traum hatte wie ein zweiter,
woraus sich sein Schicksal als vorbildlicher Märtyrer formte – ich glaube nicht
daran, denke nicht, dass zwei Menschen exakt denselben Traum in einer Nacht
(oder in einem Leben) träumen können.
Doch vielleicht irre ich mich; vielleicht träumt diese
Nacht irgendwo irgendjemand exakt denselben Traum wie ich, vielleicht erwacht
dieser jemand mit exakt derselben Empfindung, exakt denselben Bildern aus
diesem Traum. Um das zu erfahren, müsste man natürlich darüber reden.
Mittwoch, 28. März 2018
Dienstag, 20. März 2018
Broschs Dokumente
Einen beeindruckenden Menschen zu treffen, ist wie für einen
Sieg belohnt werden, von dem man nichts wusste. Klemens Brosch, so heißt er, der
Außergewöhnliche, der Manische, dem ich heute begegnen durfte; genauer: seinem
Werk; noch genauer: seinen Dokumenten. Der vielleicht geheimnisvollste, große Zeichner seiner Generation, der seltene Solitär, in dem sich grenzenloses Talent mit
unendlicher Ausdauer vereinten, der Wunderknabe, der schon künstlerisch „fertig“ war, noch ehe ihn die Kunstakademie aufnahm, er trifft mich heute für ganze
acht Stunden Dienst, und es ist keinen Moment zu lang, unser Treffen.
Schon ein erster, kurzer Blick auf seine vollendeten Tusche-
und Bleistiftmeisterschaften, deren Detailgrad stets unglaubhafte Züge annimmt (das
Museum tut gut daran, Lupen für die Ausstellung bereitzustellen: Broschs
detaillierte Grashalmlegionen sind mit freiem Auge nicht zu ermessen), er verdeutlicht, dass Brosch nur die Jahre fehlten, um heute für die Massen zu sorgen und regelmäßige Ausstellungen im In- und Ausland zu füllen. Er könnte heute vielleicht in einem Atemzug mit Ernst und Escher genannt werden, wäre er nur alt geworden, hätte er nur dem jugendlichen
Schaffen ein Haupt- und Spätwerk angehängt; logische, nächste, erfolgreiche Phasen,
hätte er sie nur erlebt – aber was nützt der
Konjunktiv, das Schaffen in Gedanken?
Sein vorzeitiges Ende (was heißt das eigentlich immer – "vorzeitig"? Wann wäre es denn zeitig, zu sterben?) war laut Arztbericht frei gewählt, ich bin nicht überzeugt davon: Selbstmord ist nicht gleichbedeutend mit Selbstbestimmung. Schuld am frühen Ausscheiden aus seinem Leben war der Krieg, dann die Droge, dann erst der
Künstler und Süchtige Klemens Brosch, der mit 32 Jahren nicht mehr konnte und wollte.
Vielleicht hoffte er noch, bis zuletzt, als er sich höchstdramatisch am
Friedhof vergiftete – ich weiß es nicht und muss es nicht wissen. Denn es
stimmt nicht, ich glaube nicht an die Hoffnung. Nicht sie stirbt
zuletzt, sondern das Werk. Und noch lebt es, noch atmet seine letzte
Hinterlassenschaft, die ihm dieser Weltkrieg – der später der Erste sein sollte – auch mit dem Tod nicht nehmen konnte: seine Kunst.
Albert Camus hat es so formuliert: „Man verneint den Krieg nicht. Man muss durch ihn sterben oder durch ihn leben.“ Brosch musste durch
ihn sterben, und das überaus langsam und überaus qualvoll, noch Jahre später
(obwohl er nur fünf Wochen diente) ließen ihn Massaker und Morpheum nicht in
Ruhe, zogen ihn die Bilder und die Ärzte unnachgiebig in die Friedhofserde hinab und nahmen ihm das kurze Leben; doch nur das eine. Sein körperliches Dasein starb mit 32
Jahren, sein künstlerisches aber zeigt mir heute, über neunzig Jahre später, was Camus auf den Existenzpunkt bringt: „Schaffen
heißt: zweimal leben.“
Und vielleicht ist dieses zweite Leben gar nicht in Zeit
bestimmbar, sondern nur in sich selbst, in seiner eigenen, selbstbestimmten
Einheit. Wenn das stimmt, dann war die Maßeinheit von Klemens Broschs zweitem
Leben der Strich. Der harte, leichte, lange, kurze, zarte, helle, schwere, klare, schwarze, unzählbare.
Millionen, Abermillionen von Broschstrichen sind es, die mich an diesem heutigen Tag
treffen, die in Reih und Glied an den Wänden stehen, in unendlicher Ausdauer,
und mir heute zeigen, dass die grenzenlos talentierte, intuitiv erfasste Strichanordnung
gewaltiger und bedrückender und beeindruckender wirken kann als alle
Kriegsfotografien (die Brosch zur Verfügung standen). Seine unglaubhaft
präzisen Zeichnungen von einem invaliden Schuhpaar, von zerfetzten Gliedmaßen im schneebedeckten Wald und
verhungerten Flüchtlingen im feuchten Straßengraben sind mir heute die bisher stärksten Dokumente einer unerklärlichen Zeit, die, vor allem anderen, von Selbstzerstörung
geprägt war.
Klemens Brosch scheint das erkannt zu haben. Und er kam ihr zuvor. Er nahm sich
das eine Leben, und behielt sich das zweite. Er hinterließ seiner Witwe tausend Werke aus sechzehn Schaffensjahren. Und allein die Chance zu haben, ihn hier und
heute wiederzusehen, in seiner ersten posthumen Schaffensschau in dieser Großstadt überhaupt,
hier auf seine strichlierten Dokumente zu treffen, auf die detaillierten, grausamen, schönen und oft phantastischen Zeichenwelten, scheint mir wie der letzte große Sieg des zweiten Broschs. Ein Sieg, von dem der erste nichts wusste, auf den er nicht einmal hoffen konnte – für den er einfach nur
werkte.
Dienstag, 27. Februar 2018
Der Philosoph
Ich bin am Nachhauseweg eines langen Tages, sitze in der
Straßenbahn, schon seit Jahren ohne Musik. Kopfhörer liegen mir nicht, sie stören und hindern mich daran, die schiefe Mehrstimmigkeit der ungeprobten Welt zu verfolgen, in deren Mitte ich Platz nehmen darf. Sie fährt unbeheizt, die Welt,
und noch während ich sitze, raubt mir die Kälte das Fingerspitzengefühl – ich hetze verzweifelt hinterher, will sie zur Rede stellen, will sie verstehen, doch sie antwortet
nicht, zeigt keine Reue, nicht einmal Einsicht. Sie macht mir Angst, diese
Kälte, schon seit Jahren.
Es sind mir zu viele Stationen heute, die Glieder drängen nach Wärme und Bewegung und ich will, ich muss mich
ablenken, aufwärmen, bereue zum ersten Mal, keine Musik in den Ohren zu haben; und dann erkenne ich ihn. Ich
war mir nicht sofort bewusst, dass er es ist, dass auch er Platz genommen hat
in meiner reglos frierenden Welt. Doch kein Zweifel besteht, als er anfängt, seine Gedanken mit ihr zu teilen.
Er sitzt in der Reihe vor mir, ich schätze ihn sechs, vielleicht sieben, neben ihm sitzt die Mutter und starrt aus dem Fenster oder sonstwohin. Nach langer Stille ergreift er das Wort. „Als Baby“, erklärt der
Philosoph seiner Mutter langsam, „muss man eigentlich nie Angst haben.“ Es
folgt eine angemessene Nachdenkpause, und gleich darauf dürfen meine kalten, offenen,
kopfhörerfreien Ohren daran teilhaben, wie der junge Philosoph seiner These das
Exempel reicht. „Wenn ich zum Beispiel in einem Korallenriff tauche, dann muss
ich dabei immer Angst haben, dass mich eine Qualle sticht. Aber wenn ein Baby
in einem Korallenriff taucht, muss es keine Angst haben. Weil die Mutter es ja vor
den Quallen beschützt.“
Dem hat weder die Mutter, noch die Kälte, noch die
ganze verfrorene Restwelt etwas hinzuzufügen.
Freitag, 16. Februar 2018
Rudolph, neu erzählt
Seit seiner Geburt lebt Rudolph mit einer missgebildeten
Nase. Sie macht ihn anders, sie macht ihn allein. In der Schule: keine Freunde,
zu Hause: keine Liebe. Und egal, was er tut und versucht, egal, wie freundlich,
bemüht, hilfsbereit, offen und gut er sich auch gibt, im ganzen Dorf wird er
gemieden, gemobbt, ausgeschlossen und mit Blicken erniedrigt, die seine Nase
wie ein Verbrechen verurteilen. Schon bald wird er traurig, scheu, zuletzt
verbittert. Er schottet sich immer mehr von einer Welt ab, die keinen Platz für
sein Aussehen kennt, er zieht sich zurück in die tiefen Wälder, er vegetiert
wie ein Tier. Ein Rudeltier ohne Rudel.
Jahre später, in einer dunklen, todkalten Winternacht trifft er auf einen bärtigen
Geschäftsmann, der verirrt und verzweifelt durch das Schneegestöber wankt. Rudolph erkennt
ihn sofort wieder, erinnert sich schmerzvoll zurück an die Demütigung eines Sommers, als er
sich für die Stelle bewarb, die perfekte Stelle im Unternehmen des Bärtigen, er wurde sogar zum Gespräch geladen, doch
ein Blick in Rudolphs Hässlichkeit und die Stelle war besetzt. In dieser Nacht
aber, da steht der Geschäftsmann hilflos vor ihm, im roten Maßanzug, zitternd, frierend; seine
Knie sacken in den Tiefschnee, er bettelt, er weint, er brüllt, er fleht Rudolph
an, ihm den Weg aus den verfluchten Wäldern zu zeigen. Mitleidig starrt Rudolph
hinab auf das rote Elend. Zögert, denkt nach. Er, der Verstoßene, der dem Leben
nichts schuldet, der niemals Hilfe erfahren hat, er soll plötzlich helfen. Und
er hilft. Er, der die Wälder kennt wie niemand sonst, er führt den Halberfrorenen durch Schnee und Finsternis, er führt ihn – ohne je etwas dafür zu fordern – heil zurück ins warme
Dorf, zurück zu seinen Verbündeten, zu seinen Kindern, in die Arme derer, die
ihn lieben.
Samstag, 27. Januar 2018
Wahrscheinlich Gold
Ein neues Kalenderjahr, ein neues Objekt: Wieder ist alles
anders, Touristenenge und Funkverkehr sind wieder passé, stattdessen schickt mich
die Arbeit in die winzig kleine Antithese zu Fürstenpalais und Museumsschloss,
schickt mich in ein modernes Ersatzteillager, einer Art Museum auf Abruf – ein
offener, diskursiver, heller, zahnarztweißer, kleiner Kunstraum für städtische
Ankäufe und jugendliche Entdeckungen. Das Gebäude selbst entdeckt leider fast
niemand, ich betrete ein schüchternes Schmuckkästchen, das gerade den Besitzer
wechselte und nicht recht weiß, für wen es nun funkeln soll; die neue
Museumsleitung scheint niemanden im Haus zu erfreuen, eher zu beunruhigen (wie
wird es weitergehen, und wo soll das sein?). Ich kann nicht mitreden, nur
zuhören, wie so oft, versuche nachzuvollziehen, wie politisch (un)motivierte
Kulturentscheidungen getroffen werden und wozu ich überhaupt hier bin.
Über Stunden und Tage werde ich erstmal eingeschult, und das
heißt: schau dir die Kunst an, zähl die Gäste, sei freundlich, fühl dich wie
zuhause, nimm noch eine Tasse Kaffee. Ich sitze mit den Kollegen hinter der
Kassentheke – tatsächlich, ich sitze – warte auf den Andrang, der nicht kommt, lese, was da ist, und freue mich über
den Tag, der nicht schlimm ist, der nicht einmal lang ist, sondern einfach nur
ist. Ein Fastentag, der nichts braucht und nichts vermisst.
Heute sind wir zu dritt und zu viele, ein junger Mitarbeiter
vom Haus, ein Firmenkollege und ich. Der Firmenkollege ist bekannt, ich traf ihn
bereits in mehreren Objekten, er ist einer dieser bewundernswerten, offenen
Menschen, die immer etwas erzählen können und sich mit kindlicher Ausdauer an
sinnfreien Leidenschaften erfreuen. Sein Steckenpferd? Die Goldgräberei. Da
gibt es diese Schatzsucherdoku auf einer Insel, jeden Sonntag, ein
Pflichttermin. Ob ich nicht glaube, dass die Sendung echt ist? Nein, das kann
natürlich schon alles inszeniert sein, klar, aber wie spannend das gemacht ist,
sagenhaft! Obwohl die ja nie etwas finden (außer Enttäuschung), und heute Abend
gleich wieder, gleich eine Doppelfolge, nein, da muss alles passen, Cola,
Chips, alles griffbereit. Klar.
Nein, er wisse schon, das ist vielleicht nichts, aber man muss
sie sich behalten, diese kleinen Siege, und außerdem erhält man da wertvolle
Tipps. Immer wieder kommt er an diesem Museumssonntag auf die Insel und das
Goldthema zurück, und ich merke bald, dass ihn die Goldgräberei wirklich beschäftigt. In den besucherleeren
Stunden googelt er Metallsuchgeräte, zeigt mir einen Anbieter in der Stadt,
wägt den Preis ab, erzählt von seiner Herangehensweise: Man muss bei den
lokalen, heimischen Sagen anfangen, dort ist der Start. Man muss lesen und aussieben,
in welchen Tälern von Gold die Rede ist, und dort beginnen. Ja, natürlich ist es unwahrscheinlich, dort noch was zu finden, aber wenn!
Der Tag geht weiter und weiter, das Außenlicht nimmt langsam
ab, noch eine Stunde. Irgendwann erwähne ich, dass ich schreibe, der Kollege
gibt mir ein paar Tipps von Stephen King weiter, wir reden über Texte und Wahrscheinlichkeiten,
bis sich schnell wieder die Insel in den Vordergrund drängt … und diese endlose
Suche nach diesem verfluchten Goldschatz, von dem niemand sicher weiß, ob er
überhaupt existiert. Und vielleicht, denke ich später, vielleicht ist gerade das
der Reiz an der Goldgräberei: nach etwas zu schürfen, das vielleicht gar nicht
da ist, einer Aufgabe zu folgen, die vielleicht vollkommen sinnlos, ziellos und
für immer unabgeschlossen bleibt, und gerade in dieser Absurdität den Traum
atmet, in dem es nicht mehr um den eigentlichen Gewinn geht, sondern um das bloße
Versinken in der Idee eines Gewinns.
Vielleicht (sehr wahrscheinlich) finde ich ein Leben lang nichts – doch ich
habe geatmet, ich habe geschürft und ich habe nicht aufgehört.
Kurz vor Schichtende nimmt mich der Kollege zur Seite und
sagt mir mit breitem Grinsen, die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann mal
ein echtes Stück Gold findet, ist größer, als dass ich mal von der Schriftstellerei
leben kann. Darauf sein Lachen, komödienhaft, und wenig später ergänzt er, das
war natürlich nicht ernst gemeint, das wisse ich schon. Ich weiß es, klar, er
ist einer von den Guten, den natürlich Guten, die ernsthaft Böses gar nicht aussprechen
können. Und doch ist etwas Wahres dran: Denn obwohl sein Vergleich mit dem
Schreiben und dem Gold nicht ernst gemeint war, obwohl nur unbedacht im Spaß
gesagt, so hat er, ohne es zu wissen, absolut Recht damit.
Dienstag, 23. Januar 2018
Relationen (VIII)
Ich faste; verzichte auf Vollzeitlohn, auf Anerkennung, auf Sicherheit. Ich faste; verzichte auf Zeitmangel, auf Anpassung, auf Selbsttäuschung.
Montag, 15. Januar 2018
Montag, 8. Januar 2018
Ein seltenes Gespräch
„Excuse me, what are they doing?“, fragt mich eine
Besucherin mit müder Stimme und deutet auf die großflächige Videoprojektion der
Themenausstellung, die ich neuerdings bewache; eine erstaunliche, erhellende, herrlich
komische und außerordentlich schöne Ausstellung über das Alter und Altern in all seinen
Facetten, ein Konzept, das Malerei, Fotografie und Video selten stimmig
vereint. Ich erkläre der Besucherin mit meinem naiven Enthusiasmus, das Video (in dem
eine galant gekleidete Seniorengruppe einen paarungswilligen Ausdruckstanz
vorführt) sei Teil einer längeren Tanzperformance der berühmten deutschen
Choreografin Pina Bausch. Ich erkläre ihr, das Besondere daran sei, dass alle Tänzer
und Tänzerinnen bereits älter als 65 wären, was damals, zur Entstehungszeit, im Jahr
2000, eine künstlerische Revolution auslöste, weil alte Körper davor nicht als
schön … und das eben das revolutionäre … Ich stocke.
Ein Blick in das Gesicht der Besucherin, er genügt: Sie lauscht
meinen bemühten Ausführungen sichtlich unbeeindruckt und mit einem betonten,
katzenhaften Desinteresse, die Antwort scheint ihr schon sichtlich zu lang und schon
lange zu mühsam; nachdem mein letzter Satz langsam und schwach abebbt, bedankt
sie sich müde und geht weiter in die nächsten Räume, wo der Gesichtsausdruck
bereits wartet.
Es ist immer wieder bemerkenswert, denke ich, wie viel die Betrachtung
eines Kunstwerkes (auch noch des schlechtesten) über den Betrachter aussagt. Die
meisten Gäste schmunzeln, kichern und lachen mit diesen liebenswerten, hüftschwingenden
Tanzpensionisten aus dem Wuppertal, manche lesen sich aufmerksam den Begleittext
zu Pina Bauschs Kontakthof im Kontext
durch, andere fragen mich, was die im Video da tun. Und immer wieder erhalte
ich solche Fragen, als sei ich (wie jeder Museumsaufseher) ein renommierter,
altehrwürdiger Kunstexperte, aber meistens, da folgt der Frage gar kein echtes,
reges Interesse an ihrer Antwort, da wird sie allein deshalb gestellt, um sich selbst
mitzuteilen. Um mir fragend zu zeigen, was sie für sich bereits glaubt zu
wissen. Weil das Urteil bereits feststeht und nur noch fragend verlautbart
werden muss. Und egal, welche Antwort darauf kommt, egal, ob sie gefällt oder
nicht, besonders, wenn sie nicht gefällt – sie wird egal sein.
Freitag, 5. Januar 2018
Diät
Manchmal überfordert mich bereits der Einkauf. Nicht selten
verlasse ich den viel zu großen, viel zu vielfältigen Supermarkt mit ein, zwei
oder gar keinem Produkt, weil ich wieder einmal nicht sagen kann, worauf ich
überhaupt Lust oder gar Hunger gehabt hätte. Es ist die Auswahl, die mich dabei
plagt, die Unmengen an Produktvarianten, die sich im tiefkühlkalten Wettbewerb
messen, die dutzenden Brotlaibe und Kornwecken, die europäische Wurstunion, das
unnötig breite Sortiment an kaum zu unterscheidenden Joghurt-, Milch- und
Käsesorten. Es ist immer zu viel, nicht zu wenig, die Regale sind zu lang und
zu zahlreich, meine Augen kommen dem Bauch nicht hinterher und bis ich am Ende
weiß, wonach ich greifen soll, ist der Hunger meist schon vergangen.
Sie liegt mir einfach nicht, die Konvention der
Vorausplanung, der hamsternde Vorratkauf, der immer voran blickt, weit voraus, am
nächsten Tag vorbei, wo ich nichts sehe, nicht einmal Hunger. Vorausplanen kann
ich nur im Schreiben, und selbst da nur soweit, wie es der Gedanke zulässt, der
mich lenkt, motiviert und überrascht. Nie aber überraschen mich die
Supermärkte, sie füttern nur mein Zaudern und Überdenken. Der Kühlschrank in
meiner Wohnung ist stets halbleer, nicht halbvoll – die Außenmaße sind ihm klar zu
weit, und meine überzeugungsbefreite, unsichere Entscheidungsfindung ist keine
Hilfe für sein Ansehen.
Es liegen weder Witz noch Ironie in der Erkenntnis: Es sind
meine Zweifel, die mich schlank halten.
Abonnieren
Posts (Atom)